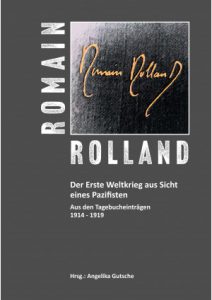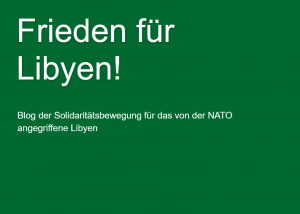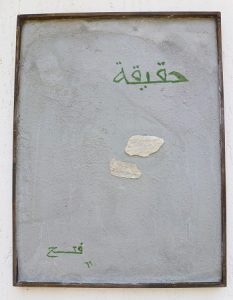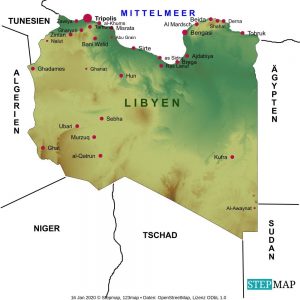Rezension: Der zweite Band von Michael Sailers „Notate aus Zeiten von Lüge und Krieg“ ist erschienen. Trug der erste Band den Titel „Was ist passiert?“, fragt der zweite Band: „Ist was passiert?“ Ja, es ist was passiert! Und das, was passiert ist, darf nicht in Vergessenheit geraten, auch wenn der Mensch gerne dazu neigt, Schreckenszeiten zu verdrängen. Das Lesen von Michael Sailers Buch beugt dem vor, ist ein Akt der Wiederbewusstmachung. Der Autor lehrt uns noch einmal das Gruseln über den Wahnsinn, der die Welt ab 2020 befallen hat.
Rezension: Der zweite Band von Michael Sailers „Notate aus Zeiten von Lüge und Krieg“ ist erschienen. Trug der erste Band den Titel „Was ist passiert?“, fragt der zweite Band: „Ist was passiert?“ Ja, es ist was passiert! Und das, was passiert ist, darf nicht in Vergessenheit geraten, auch wenn der Mensch gerne dazu neigt, Schreckenszeiten zu verdrängen. Das Lesen von Michael Sailers Buch beugt dem vor, ist ein Akt der Wiederbewusstmachung. Der Autor lehrt uns noch einmal das Gruseln über den Wahnsinn, der die Welt ab 2020 befallen hat.
Die Lektüre ist dank des superben und gewitzten Sprachstils des Autors und seiner gnadenlosen Demaskierung der Verantwortlichen gleichzeitig auch ein Akt der Befreiung.
Kategorie: Rezensionen (Seite 1 von 5)
Literatur – Film – Medien
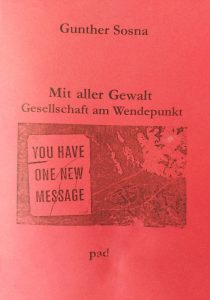 Rezension. Die Schrift „Mit aller Gewalt. Gesellschaft am Wendepunkt“ umfasst verschiedene Essays des Autors Gunther Sosna. Mit Rückgriff auf die Gedankenwelt von Erich Mühsam und anderen Anarchisten beschwört Sosna, dessen Hauptanliegen die Überwindung von Armut und Elend ist, das Ende der Herrschaft des Menschen über den Menschen als Weg, um Kriege und soziales Chaos zu bezwingen.
Rezension. Die Schrift „Mit aller Gewalt. Gesellschaft am Wendepunkt“ umfasst verschiedene Essays des Autors Gunther Sosna. Mit Rückgriff auf die Gedankenwelt von Erich Mühsam und anderen Anarchisten beschwört Sosna, dessen Hauptanliegen die Überwindung von Armut und Elend ist, das Ende der Herrschaft des Menschen über den Menschen als Weg, um Kriege und soziales Chaos zu bezwingen.
Müssen wir uns aus der „Zwangsjacke“ des Staates befreien?
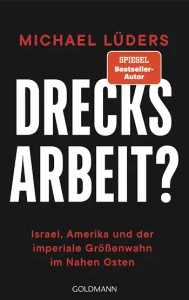 Rezension. In seinem neuen Buch über die Spannungslage im Nahen Osten nimmt Michael Lüders mit großer Sach- und Detailkenntnis zunächst das aktuelle Geschehen insbesondere im Iran, aber auch im Irak und Jemen, unter die Lupe, bevor er überschwenkt zum Gazakrieg, zu Israel und Palästina, unter Bezugnahme auf die neuesten Entwicklungen in Syrien und im Libanon. Für jeden, der die Geschehnisse in dieser Weltregion verstehen will, bietet dieses Buch mit seinem präzisen Blick auf die Konflikte eine schlüssige geopolitische Analyse der politischen Umbrüche, deren Entwicklung, mit ungewissem Ende, noch lange nicht abgeschlossen ist.
Rezension. In seinem neuen Buch über die Spannungslage im Nahen Osten nimmt Michael Lüders mit großer Sach- und Detailkenntnis zunächst das aktuelle Geschehen insbesondere im Iran, aber auch im Irak und Jemen, unter die Lupe, bevor er überschwenkt zum Gazakrieg, zu Israel und Palästina, unter Bezugnahme auf die neuesten Entwicklungen in Syrien und im Libanon. Für jeden, der die Geschehnisse in dieser Weltregion verstehen will, bietet dieses Buch mit seinem präzisen Blick auf die Konflikte eine schlüssige geopolitische Analyse der politischen Umbrüche, deren Entwicklung, mit ungewissem Ende, noch lange nicht abgeschlossen ist.
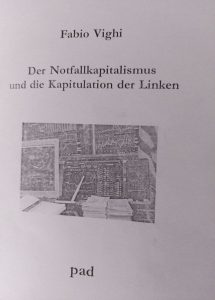 Rezension. In seiner Schrift „Der Notfallkapitalismus und die Kapitulation der Linken“ beschreibt Fabio Vighi den zerstörerischen Weg des senilen Krisenkapitalismus, den dieser rücksichtslos zu seiner eigenen Rettung eingeschlagen hat, und die Blindheit der Linken, deren überholte Denkschablonen verhindern, dies zu erkennen.
Rezension. In seiner Schrift „Der Notfallkapitalismus und die Kapitulation der Linken“ beschreibt Fabio Vighi den zerstörerischen Weg des senilen Krisenkapitalismus, den dieser rücksichtslos zu seiner eigenen Rettung eingeschlagen hat, und die Blindheit der Linken, deren überholte Denkschablonen verhindern, dies zu erkennen.
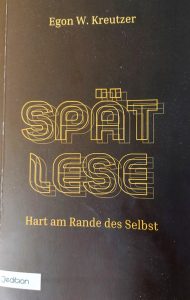 Rezension. Das neue Buch von Egon W. Kreutzer ‚Spätlese‘ hält, was der Untertitel ‚Hart am Rande des Selbst‘ verspricht. So führt der Autor in seinem Alterswerk als Ich-Erzähler das Gespräch mit dem eigenen Selbst, dem ‚Er‘. Das ‚Ich‘ und das ‚Er‘ wiederum ergeben das ‚Wir‘ – eine fast kafkaeske Reflektion über Bewusstes und Unbewusstes.
Rezension. Das neue Buch von Egon W. Kreutzer ‚Spätlese‘ hält, was der Untertitel ‚Hart am Rande des Selbst‘ verspricht. So führt der Autor in seinem Alterswerk als Ich-Erzähler das Gespräch mit dem eigenen Selbst, dem ‚Er‘. Das ‚Ich‘ und das ‚Er‘ wiederum ergeben das ‚Wir‘ – eine fast kafkaeske Reflektion über Bewusstes und Unbewusstes.
In diesem Lesebuch für Philosophen und solche, die es werden möchten, begibt sich Egon W. Kreutzer auf die Suche nicht nur nach dem Baum der Erkenntnis, um davon den einen oder anderen Apfel zu pflücken – denn die Sünde sei die Vorbedingung, aber keinesfalls eine Garantie, des Menschseins –, sondern er möchte gar zu den Wurzeln des Baumes gelangen.
 Die Autoren Wolfram Elsner und Wolfgang Krieger zeigen in dem Heft „Vom Industrie- zum Finanzkapital“ in einem historischen Abriss den Aufstieg, Zenit und Abstieg des Finanzkapitals auf.
Die Autoren Wolfram Elsner und Wolfgang Krieger zeigen in dem Heft „Vom Industrie- zum Finanzkapital“ in einem historischen Abriss den Aufstieg, Zenit und Abstieg des Finanzkapitals auf.
Den Autoren ist es auf anschauliche Weise gelungen, die „Dialektik des Kapitals bei Marx abzuholen“ und in die „Aufstiegs- und Niedergangs-Prozesse des Finanzkapitals und seines Herrschaftssystems“ fortzuführen. Und so erklären sich die heutigen imperialen Kriege nicht mehr nur „aus den Gewinninteressen des militärisch-industriellen Komplexes, sondern aus den globalen geostrategischen Interessen des Gesamtsystems eines umfassend herrschenden Finanzkapitals“ .
 Rezension. 2025 erschien im PapyRossa-Verlag der Band „Thomas Sankara“ von Gerd Schumann. Die lohnende Lektüre dieser kurzen Biographie des Revolutionärs und ehemaligen Präsidenten von Obervolta/Burkina Faso, in dessen Nachfolge sich der heutige Übergangspräsident von Burkina Faso, Ibrahim Traoré, sieht, ist eine große Hilfe für das Verständnis der aktuellen Vorgänge nicht nur in den Sahelstaaten, sondern auch in anderen Teilen Afrikas. Aus dem Vermächtnis eines Thomas Sankara und anderer revolutionärer afrikanischer Führer speist sich die Kraft zum Kampf für den Aufbau einer hoffnungsvollen Zukunft.
Rezension. 2025 erschien im PapyRossa-Verlag der Band „Thomas Sankara“ von Gerd Schumann. Die lohnende Lektüre dieser kurzen Biographie des Revolutionärs und ehemaligen Präsidenten von Obervolta/Burkina Faso, in dessen Nachfolge sich der heutige Übergangspräsident von Burkina Faso, Ibrahim Traoré, sieht, ist eine große Hilfe für das Verständnis der aktuellen Vorgänge nicht nur in den Sahelstaaten, sondern auch in anderen Teilen Afrikas. Aus dem Vermächtnis eines Thomas Sankara und anderer revolutionärer afrikanischer Führer speist sich die Kraft zum Kampf für den Aufbau einer hoffnungsvollen Zukunft.
 Rezension. Michael Sailers Corona-Blogbeiträge liegen nun in Buchform vor. Der erste von drei Bänden trägt den Titel „Was ist passiert? – Notate aus Zeiten von Lüge und Krieg. Band eins 2020/2021“.
Rezension. Michael Sailers Corona-Blogbeiträge liegen nun in Buchform vor. Der erste von drei Bänden trägt den Titel „Was ist passiert? – Notate aus Zeiten von Lüge und Krieg. Band eins 2020/2021“.
 Rezension. In ihrem Buch „Krieg in Nahost. Geopolitik, Verwüstung, Widerstand und Aufbruch einer Region“ gibt Karin Leukefeld einen kompakten geschichtlichen Abriss des Nahostkonflikts. Fast wie ein Nachschlagewerk leistet es einen ausgezeichneten Beitrag zum Verständnis der aktuellen Geschehnisse in der westasiatischen Region, mit dem Fokus auf Palästina.
Rezension. In ihrem Buch „Krieg in Nahost. Geopolitik, Verwüstung, Widerstand und Aufbruch einer Region“ gibt Karin Leukefeld einen kompakten geschichtlichen Abriss des Nahostkonflikts. Fast wie ein Nachschlagewerk leistet es einen ausgezeichneten Beitrag zum Verständnis der aktuellen Geschehnisse in der westasiatischen Region, mit dem Fokus auf Palästina.

.